Der Raub
[Kurzgeschichte. Veröffentlicht in Fantasia 1226e. 2025]
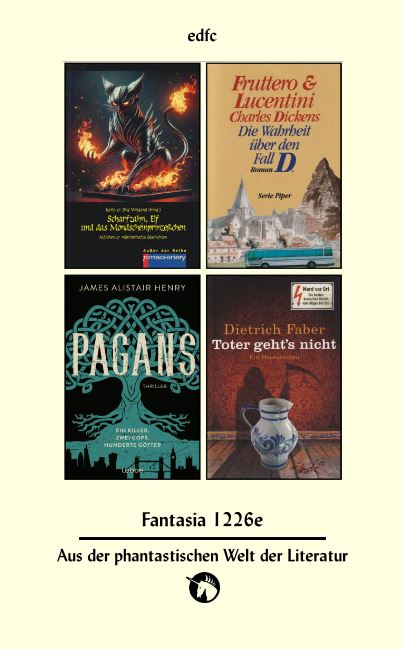
Der Raub
Paris, das in jenem Sommer des Jahres 1911 zwischen der Eleganz seiner Boulevards und der steten, nie wirklich ruhenden Strömung aus Theaterpremieren, Cafégesprächen, dichterischer Avantgarde und technischer Moderne wie eine ungeduldige Hauptstadt der Welt schimmerte, legte an Montagen eine andere Gangart ein, weil die großen Häuser an diesem Tag der Woche schlossen, und eben dieser Montag, der 21. August, mit dem gemächlichen Schritt der Hausdienste und Handwerker, die in grauen Kitteln zwischen Marmor und Meisterwerken umherschritten, sollte zum paradoxen Symbol einer Lässigkeit werden, die dem Ungeheuerlichen Vorschub leistete, denn die Stadt der Lichter, deren Selbstgewissheit sich in jedem Schaufenster und jeder eleganten Promenade spiegelte, war im Begriff zu lernen, dass die größte Sensation dort beginnen kann, wo die Wachsamkeit am kleinsten ist.
Wer den Salon Carré betrat, sah, wie sich die Stille der geschlossenen Räume vor einem ausbreitete wie eine Bühne ohne Orchester, und wer – wie Vincenzo Peruggia – schon zuvor als Anstreicher und Glaser im Auftrag externer Firmen für den Louvre gearbeitet hatte, kannte die Prozeduren, die Gewohnheiten, die kleinen Abkürzungen und das selbstvergessene Vertrauen, das man einer weißen Arbeitsbluse entgegenbrachte, sodass der schlichte Akt, ein Bild von der Wand zu nehmen, zur konsequenten Fortsetzung eines alltäglichen Bewegungsmusters wurde, das außer dem Mut und der Unverfrorenheit des Tatentschlusses nichts Spektakuläres benötigte, weil der wahre Skandal nicht der Einbruch war, sondern die offene Tür, die sich gesellschaftlich und institutionell bereits vor dem Täter auftat.
Als Peruggia das Gemälde von der Wand gehoben und in ein Diensttreppenhaus getragen hatte, wo er die Schutzverglasung löste, den Rahmen entfernte und dann, mit dem Gewicht einer plötzlich allzu weltlichen Ikone in den Händen, vor einer verschlossenen Tür stand, kam ihm das Glück in Gestalt eines arglosen Klempners zu Hilfe, der – von den kleinen Dramen der Haustechnik bewegt, nicht von der Größe eines Kunstverbrechens beunruhigt – beim Lösen und Montieren eines Knaufs half, wodurch ein Augenblick der Peinlichkeit, womöglich der Entdeckung, sich in eine Geste unbewusster Komplizenschaft verwandelte, während in diesem Treppenhaus der Rahmen, die Glasscheibe und ein Daumenabdruck zurückblieben, der später wie ein stummer Vorwurf an die Ordner der Ermittlungsakten haften sollte.
Die Entdeckung der Leerstelle, die am Dienstag, dem 22. August, durch den Maler und Kopisten Louis Béroud ihren ersten staunend gesprochenen Satz fand, geriet zunächst zur Farce, weil man die Möglichkeit erwog, das Bild sei ausgeliehen oder im Studio, und als die Sicherungen, Nachfragen und Kontrollen das Gegenteil erbrachten, begann ein Schaudern im Mauerwerk, das man beinahe hören konnte, denn der Louvre schloss seine Tore für eine Woche, und die Polizei, die mit dem Stolz der Moderne auf neue Methoden wie die Fingerabdrucktechnik verwies, hatte zwar einen Abdruck aus dem Treppenhaus, aber keinen Adressaten dafür, keinen Namen, keinen schnellen Treffer, der den Zorn der Öffentlichkeit in Bewunderung für kriminalistische Nüchternheit verwandelt hätte.
Die Ermittlungsarbeit, die in den ersten Tagen und Wochen von Eifer, Druck, öffentlicher Erwartung und der Notwendigkeit, eine demütigende Lücke zu füllen, gleichermaßen befeuert wurde, bewegte sich zwischen konsequenter Spurensuche und theatralischen Gesten, wie sie die Verhaftung Guillaume Apollinaires am 7. September und die Vernehmung Pablo Picassos exemplarisch zeigten, denn der Verdacht folgte der Nähe zur künstlerischen Avantgarde mehr als dem kalten Maß der Beweise, und obgleich man den Rahmen, die Glasvorrichtung, den Abdruck und eine Reihe von Zeugenaussagen besaß, fehlte die nüchterne Verknüpfung, die den unscheinbaren Arbeiter im weißen Kittel als das ins Visier rückte, was er tatsächlich war, während gleichzeitig die Institutionen, die ihr Selbstbild aus Ordnung, Wache und Tradition bezogen, zusehen mussten, wie ihnen der Sockel unter den Füßen zu wanken begann.
Je länger die Leerstelle dauerte, desto mehr füllten sie die Blätter der Zeitungen, die den Mangel zur Ware machten und das Verschwinden zur größten aller Sichtbarkeiten erhoben, und von New York bis St. Petersburg, von den Karikaturisten der Satireblätter bis zu den nüchternen Spalten der großen Gazetten, begann ein tägliches Theater des Rätselns, in dem angebliche Geständnisse, anonyme Hinweise, hochstaplerische Legenden und kulturpolitische Deutungen zu einem Reigen verschmolzen, der die Öffentlichkeit atemlos hielt, wobei der Refrain stets derselbe blieb – wo ist sie, die Frau mit dem rätselhaften Lächeln –, und die Medien, die die Gegenwart sonst mit tausend kleinen Geschichten beschallten, fanden plötzlich in der Abwesenheit des Bildes die lauteste Erzählung ihrer Zeit.
Unterdessen lebte das Gemälde ein stilles, beinahe monastisches Dasein in einer schlichten Pariser Einzimmerwohnung nahe dem Canal Saint-Martin, wo Peruggia es, in Tuch geschlagen, in einer Truhe verbarg, als brauche das weltberühmteste Gesicht der Renaissance einen hölzernen Kokon, um die rauschhafte Welt der Schlagzeilen draußen zu halten, und man möchte sagen, dass in dieser Dunkelheit, unter dem Bett, zwischen Kreisschlüssel, Rechnungszetteln und dem gleichmäßigen Atem des Schlafenden, eine andere Art der Geschichte stattfand, denn hier war sie, die Mona Lisa, nicht Objekt von Besitzansprüchen, Nationalismen oder der Logik der Institutionen, sondern ein schweigendes Bild, das einen Mann zum Hüter seiner eigenen Legende machte, obwohl ihn die Welt nicht Hüter, sondern Dieb nannte.
Die psychologische Kontur dieses Mannes, der aus Italien nach Paris gekommen war, um Arbeit zu finden und der die Räume des Museums aus der niedrigsten, aber intimsten Perspektive kannte, lässt sich nicht in einem einzigen Motiv festhalten, denn sein Patriotismus war, so wie er ihn vortrug, ein Gemisch aus verletztem Stolz, historischer Unkenntnis und dem tiefen Wunsch, einem als übergroß empfundenen Frankreich eine Handvoll symbolischer Gerechtigkeit zu entwinden, während zugleich die Aussicht auf Lohn, Anerkennung oder wenigstens die entlastende Geste einer vermeintlichen Heimführung wie ein schweigender Mitwisser in seinen Bewegungen lag, wodurch der Täter, den die Gerichte später milder beurteilten, weil er von der Nation sprach und nicht vom Gewinn, in Wahrheit zwischen den beiden Polen eines kleinteiligen Eigennutzes und eines grandios missverstandenen Pathos hin- und hergerissen blieb.
Die Polizei, die in den Monaten nach der Tat mehrere Wellen von Nachforschungen unternahm, legte Akten an, sortierte Aussagen, verfolgte Hinweise, wertete Fingerabdrücke aus, und doch entstand, wie so oft in großen Apparaten, ein Schattenraum zwischen Daten und Deutung, in dem das eine richtige Zeichen – der Abdruck aus dem Treppenhaus, die nahe Handwerkersphäre, das so plausible Szenario des Kittels – zwar vorhanden, aber nicht gebündelt war, als mangele es weniger an Fakten als an dem verknüpfenden Blick, der aus verstreuten Spuren eine Linie macht, weshalb auch die öffentlichkeitswirksamen Ermittlungsakte, die man im Namen der Entschlossenheit gegen prominente Künstler richtete, am Ende eher das Unbehagen an der eigenen Ratlosigkeit beschwichtigten, als die Wahrheit ans Licht zu ziehen.
Während die Boulevardpresse mit grellen Überschriften operierte und die ernsthaften Blätter gelehrte Kolumnen über Eigentum, Nation und Kunstgeschichte druckten, wuchs das Bild abwesenderweise in einen Mythos hinein, der jede reale Farbe überstrahlte, und weil die Leerstelle auf der Museumswand nun wie ein Reliquiar ohne Reliquie war, pilgerten Menschen dorthin, um die Abwesenheit zu betrachten, als wäre sie ein neues Werk, und man machte Witze, schrieb Chansons, fertigte Karikaturen, in denen der leere Rahmen in einem Armlehnstuhl saß, während die Mona Lisa im Nachtleben von Montmartre auftauchte, und all dies fügte sich zu jener modernen Einsicht, dass der Ruhm nicht nur in der Präsenz, sondern auch im orchestrierten Mangel eines Gegenstandes liegt.
Als dann, zwei Jahre nach dem Morgen im Salon Carré, der Mann im weißen Kittel – inzwischen wieder ein gewöhnlicher Pariser Einwohner unter vielen – den Entschluss fasste, die Stille zu brechen, und unter dem Alias „V. Leonard“ dem Florentiner Kunsthändler Alfredo Geri schrieb, um eine Rückführung des Gemäldes nach Italien in Aussicht zu stellen, begann ein zweiter, ebenso kriminalistischer Akt der Geschichte, einer, der aus Misstrauen, vorsichtigen Absprachen und der notdürftigen Tarnung einer jahrhundertealten Dame bestand, weshalb Geri den Direktor der Uffizien, Giovanni Poggi, ins Vertrauen zog, damit die Begegnung in einem Hotelzimmer des Albergo Tripoli-Italia nicht nur die Sensation, sondern auch die Autorität eines Blicks besaß, der zwischen einer Fälschung und dem originalen Werk zu unterscheiden wusste.
Die Szene im Hotelzimmer, in der das sorgfältig eingewickelte Gemälde aus seinem Stoff befreit wurde, bot den paradoxen Augenblick einer Wiedergeburt ohne Geburt, denn als die Männer die bekannten Züge sahen – die Hände, die pyramidal ruhen, das Landschaftsband, das wie ein ferner Atemzug um den Körper schwingt, das Lächeln, dessen Rätsel an diesem Tag vielleicht weniger subtil als sonst war, weil es zugleich das Ende einer zweijährigen Verwirrung bedeutete –, wussten sie, dass die Wahrheit vor ihnen lag, und während draußen das Italien der jungen Nation seine Symbole zählte, griff die Polizei zu, als wolle sie mit einer einzigen, klaren Geste all das Ungefähre tilgen, das die Ermittlungen in Paris so lange begleitet hatte.
Was folgte, glich einem nationalen Festzug, dessen kulturpolitische Choreografie selbst jenen überraschte, die im Namen der nüchternen Sache handelten, denn in Florenz und später in Mailand entstanden Schlangen vor den Museumsportalen, die zeigten, wie schnell ein Kunstwerk vom Gegenstand der Ermittlungen zum Banner der Identität werden kann, und die Uffizien, in denen man die Mona Lisa ausstellte, wurden zur Bühne einer symbolischen Heimkehr, die wenig Rücksicht darauf nahm, dass das Bild historische Wege gegangen war, die sich nicht in das einfache Vokabular des Raubes durch Napoleon fügen wollten, während dennoch überall die Erzählung der Rückkehrerin dominierte, die man hochleben ließ, bevor sie, umgeben von höflichen diplomatischen Gesten, am 4. Januar 1914 in den Louvre zurückkehrte.
Die Pinacoteca di Brera, die wenige Tage zuvor zur zweiten italienischen Station des Gemäldes geworden war, zeigte, wie die Begeisterung sich zwischen Ruhe des Museums und Lärm der Straße vermittelte, und weil im späten Dezember 1913 die Luft bereits jenen metallischen Ton annahm, den das kommende Jahr dem Kontinent bringen sollte, mischte sich in den Jubel ein leiser Unterton der Beklemmung, als ahnte man, dass die Geschichten der Nationen bald andere Farben bekommen würden, doch für den Augenblick galt nur die Freude an einer Ikone, die aus der Nacht des Verschwindens in das Tageslicht der öffentlichen Besichtigung zurückgekehrt war, und die Presse, die zwei Jahre lang Lücken gefüllt hatte, konnte nun endlich Fülle zeigen, so als sei das Gedruckte durch das Ausgestellte endlich eingelöst.
Der Prozess gegen Vincenzo Peruggia, der im Juni 1914 zu dem Urteil eines Jahres und fünfzehn Tagen führte, wobei der tatsächliche Vollzug mit rund sieben Monaten knapp ausfiel, wurde zum abschließenden Akt einer Inszenierung, die das Gericht nicht gänzlich beherrschte, denn die Verteidigung, die vom Patriotismus sprach, von der Heimführung eines unrechtmäßig in Frankreich befindlichen Schatzes, traf in den Ohren des Publikums auf einen Resonanzraum, den die Justiz zwar nicht teilen musste, aber doch nicht ignorieren konnte, weshalb die Worte des Angeklagten – ungebildet in Geschichte, sicher, aber klug genug, das Vokabular des Herzens zu sprechen – schwerer wogen, als es die schlichte Bilanz von Tat und Schaden vermuten ließ, und der Mythos, der das Bild vergrößert hatte, zeigte seine Kraft nun auch am Rand des Richtertischs.
Am Ende blieb eine Geschichte, die weniger durch technische Raffinesse als durch die Enthüllung institutioneller Gewöhnung, medialer Verstärker und menschlicher Selbstdeutung leuchtete, eine Geschichte, in der die Abwesenheit zu einer Form von Gegenwart wurde und ein Mann mit einem Kittel, einem Werkzeugkasten und einer Beharrlichkeit, die ebenso aus Irrtum wie aus Überzeugung geboren war, die Welt vorführte, wie verletzlich selbst die größten Heiligtümer sind, wenn man sie für selbstverständlich hält, und wie schnell das, was wir schützen wollen, in die Sphäre der Erzählung entgleitet, worin es zugleich unantastbarer und gefährdeter erscheint, weil es von den Blicken lebt, die es nicht sehen.
Wenn man schließlich den Salon Carré wieder betritt, in dessen luftiger Würde die Geschichte dereinst ihren Anfang nahm, und das Bild, das längst mehr ist als ein Gemälde, betrachtet, dann begreift man, dass der Ruhm, der ihm anhaftet, ein Gemisch aus künstlerischer Vollkommenheit und kriminalistischer Exposition ist, aus der Genauigkeit eines Pinsels und der Ungenauigkeit einer Welt, die ihre Aufmerksamkeiten nach dem Kalender der Sensationen verteilt, und dass das Lächeln, das so oft als unentschlüsselbar gepriesen wurde, vielleicht gerade deshalb so berühmt wurde, weil es zwei Jahre lang von niemandem gesehen wurde und in dieser unsichtbaren Zeit jene Menge an Bedeutungen ansammelte, die nur die Leere so geduldig zu speichern versteht.
Denn das Vermächtnis des Raubes, in dessen Verlauf ein Türknauf zur dramatischen Requisite, ein Fingerabdruck zur verpassten Gelegenheit, ein Dichter zur Fehladressierung des Misstrauens und ein Maler zum zufälligen Zeugen eines historischen Lochs wurde, besteht nicht allein in der Rückkehr des Werkes und dem milden Urteil gegen den Täter, sondern darin, dass eine europäische Öffentlichkeit sich im Spiegel einer fehlenden Ikone betrachtete und entdeckte, dass die Kunst nicht nur durch Schönheit gebietet, sondern auch durch Geschichte, und dass jede große Erzählung – selbst wenn sie mit einem Kittel und einer Truhe beginnt – am Ende über das hinausweist, was eine einzelne Hand greifen kann, weil sie zeigt, wie sehr die Dinge, die wir besitzen wollen, in Wahrheit uns besitzen.
Und so lässt sich die Chronik, die am 21. August 1911 mit einem Gang durch stille Museumsgänge begann und am 4. Januar 1914 mit einer Rückkehr endete, die man in Diplomatie und Pressejubel kleidete, als ein Lehrstück lesen, dessen Moral weder allein in der Klugheit des Täters noch in der Torheit der Wächter liegt, sondern in der beweglichen Grenze zwischen Ordnung und Zufall, zwischen Beweis und Erzählung, zwischen dem sichtbaren Gegenstand und der unsichtbaren Macht der Aufmerksamkeit, welche, einmal erweckt, aus jeder Lücke eine Bühne macht und aus jeder Bühne ein Tribunal, vor dem der Ruhm verhandelt wird, bis er, wie das Lächeln der Dame, zu einer stillen, unerschöpflichen Tatsache geworden ist.