Tango nuevo
[Kurzgeschichte. Veröffentlicht in: Von Gitarren, Glanz und Gänsehaut – Die Helden meiner Jugend: Ein Buch über Leidenschaft, Poster an der Wand und die Magie des ersten Konzerts. Anthologie. Zusammen mit The Arc. Experimentelle Fotographie, 2025]
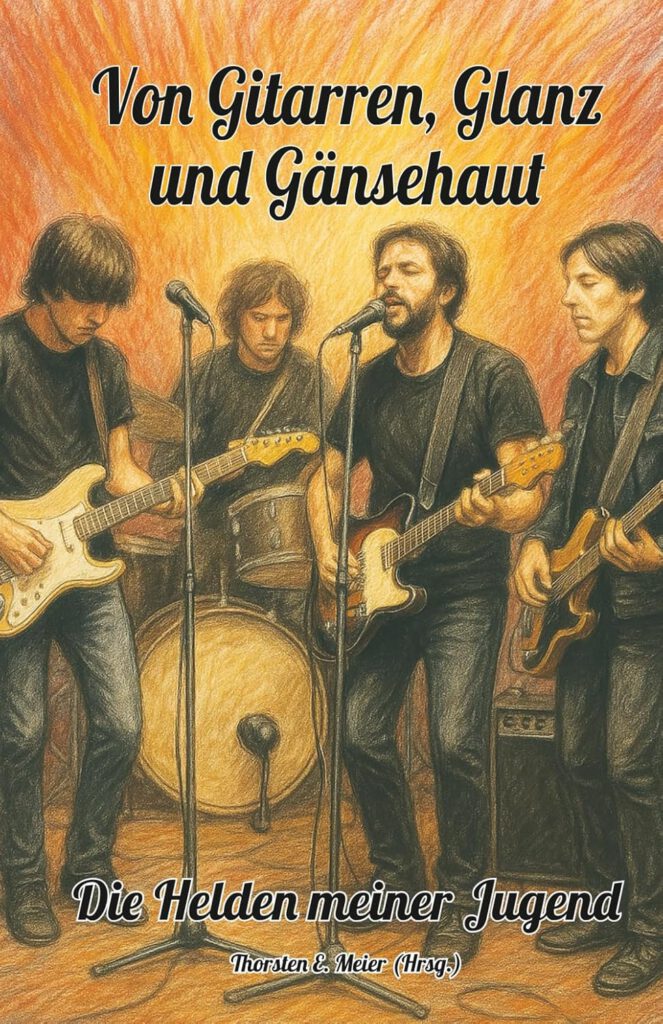
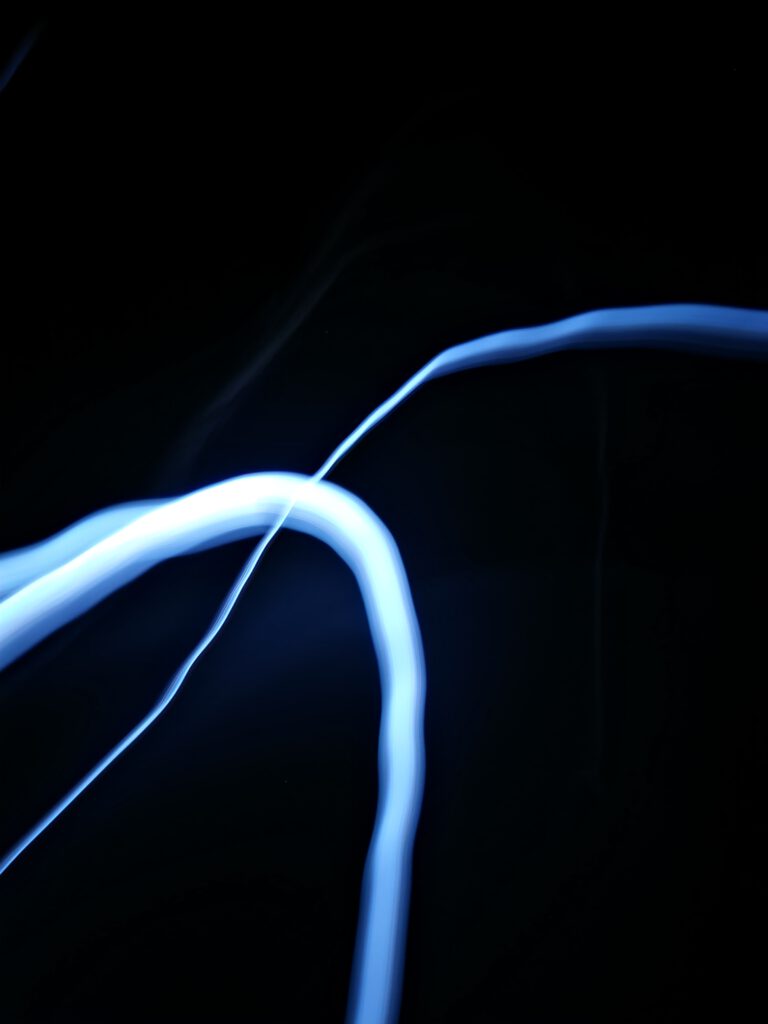
Tango nuevo
Als Astor Piazzolla Mitte der Siebziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts Argentinien verließ, da die Geißel des Putsches im Begriff war, das Land zu unterjochen, und selbst Musiker zu jenen Intellektuellen gezählt wurden, die man besser früher als später ausrottete, hätte der Tango mit ihm sterben können, als er in Mailand ankam. Doch wie ein altes argentinisches Sprichwort sagt, dass sich alles ändert, nur der Tango nicht, blieb Astor stur bei seinem Tango, den er über die Jahre weiterentwickelt hatte, und suchte nach Wegen, den Tango zwar nicht zu verlieren, ihn aber weiter zu erneuern. Diese Neuerung, das Öffnen des Tangos in Richtung Weltmusik, Jazz und klassischer Elemente, war es, die ihm spät Ruhm und einen argentinischen Heldenstatus einbringen sollte, doch wie schon andere in der Welt der Musik musste auch Piazzolla sehr lange auf die Anerkennung warten, die er erst viel später erhalten sollte. Nach Jahrzehnten der Wanderschaft zwischen Buenos Aires, New York und Paris, einer deutlichen Ansage von Nadia Boulanger, den Tango und nicht die Klassik ernst zu nehmen, dazu viele Aufnahmen und Konzerte, war der Revolutionär, der keiner sein wollte, bis in die Tiefen des Tangos eingedrungen, hatte ihn dekonstruiert und wieder neu zusammengesetzt, vermischt mit Jazzklängen, Zwölftontechnik und elektronischen Instrumenten, wollte eigentlich Evolutionär sein, wollte die Menschen zum Zuhören des Tangos bringen, doch das sahen die stolzen Argentinier nicht in seinem Werk – sie sahen Aufruhr und einen Angriff auf die Seele des einfachen Argentiniens, auf ein Herzstück der Identität, ein im alten Hafengelände La Boca, im Vielvölkergemisch der Einwanderer destillierter Tanz, der Tango, in dem viele ihre Seele gaben und sie zuweilen verloren. Piazzolla, der sich mit Borges und Ferrer traf und intensiv austauschte, wollte diese Entwicklung nicht erzwingen, sie lag tief in ihm, seit sein Vater voller Wehmut jeden Abend Tango hörte, um die Heimat nicht zu vergessen, die er von Buenos Aires in Richtung New York City losgelassen hatte, als Astor noch ein Kind gewesen war. Er perfektionierte das Bandoneon-Spiel, gründete Orchester und Gruppen, verwob Neues mit altem Material, ging auf die Suche nach dem melancholischen und pulsierenden Kern des Tangos und überschüttete diesen mit den Freiheiten des Jazz, dessen zuweilen stakkatoartigen Rhythmen eine hervorragende Symbiose mit dem Tango eingingen, als würden beide eng umschlungen miteinander tanzen und sich von nichts und niemandem in die Parade fahren lassen. In Mailand angekommen, brachte Piazzolla alles zusammen – seine kompositorische Klarheit, seine lautmalerische Spielweise des Bandoneons, die rhythmisch-melancholische Seele des Tangos und die Weltoffenheit der Musik der Siebziger Jahre. Er steuerte spät auf den Höhepunkt seines Schaffens zu und nun, in der verwandelten Welt mit ihrer neuen Offenheit, brachte der Tango nuevo, wie Piazzolla ihn nannte, bei Menschen in vielen Ländern Saiten zum Klingen, die zuvor mit dem Tango nie Berührung hatten. Am Ende seiner langen Karriere, in der Piazzolla hartnäckig, stur und perfektionistisch seinen Weg gegangen war, erreichte ihn der Erfolg der Zuhörer, und wie es einst Anton Bruckner erging, den Piazzolla in seiner Zeit an der Universität studierte, so versöhnte sich der Argentinier mit seinem Volk, das den Tango bis heute in seinem Herzen trägt.