Der Blick in die Sonne – zum Tod in Venedig
[Essay. Veröffentlicht in Dichtungsring #68. 2025]
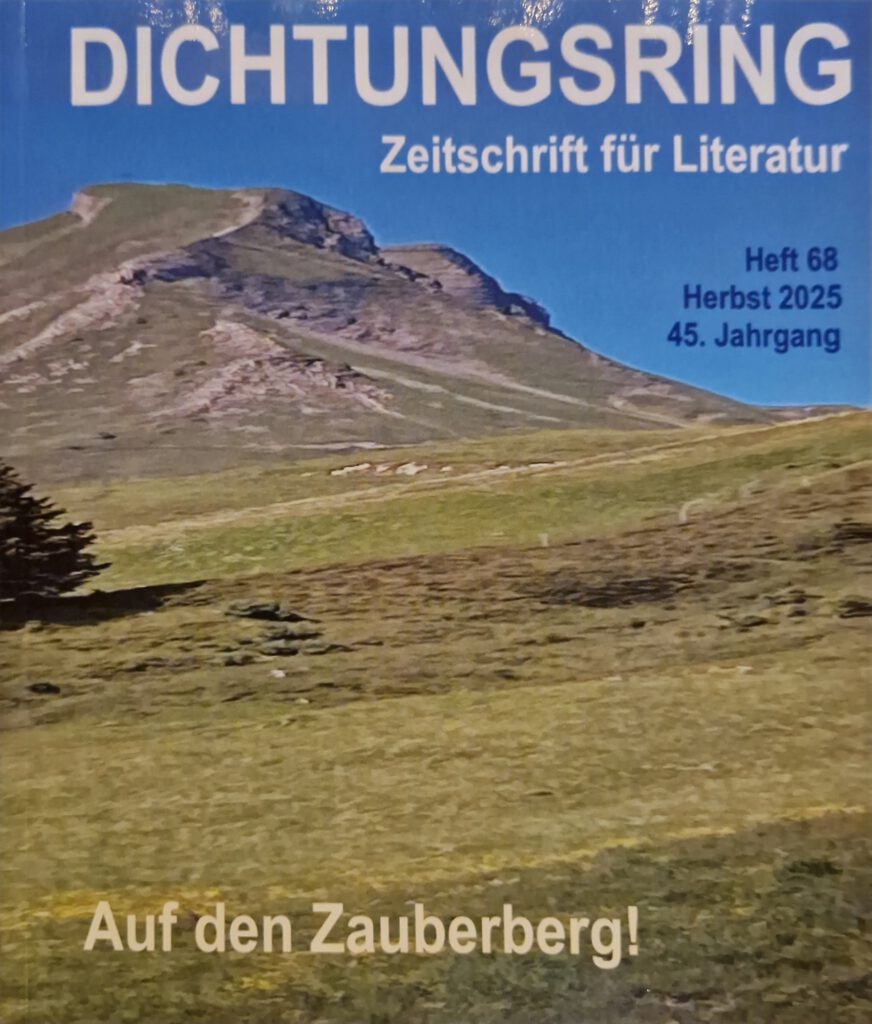
Der Blick in die Sonne – zum Tod in Venedig
Es ist, als ob der Tod, sonst ein schweigender und eher zurückhaltender Geselle, der sich gewöhnlich im Schatten verbirgt, an der Lagune von Venedig plötzlich Gefallen daran gefunden hätte, sich in seiner vollen Wirkung im Licht zu zeigen – nicht in dumpfer Finsternis, nicht in den kalten Winkeln eines Krankenzimmers, sondern in glühendem Tageslicht, auf blendend weißem Sand, begleitet vom salzigen Duft des Meeres und dem sanften, beinahe träumerischen Rauschen der Wellen, als wäre das Sterben hier nicht mehr das Ende eines mühsam getragenen Daseins, sondern der letzte, geradezu ästhetische Akt eines Mannes, der sein Leben immer schon mehr als Form denn als Gefühl, mehr als Idee denn als Leib verstanden hatte.
Gustav von Aschenbach stirbt nicht durch einen plötzlichen Schlag, nicht in einer heroischen Geste der Aufopferung und vor allem nicht als Opfer eines äußeren Schicksals, sondern er stirbt – fast unmerklich – an der tief in ihm angelegten Unfähigkeit, sich der Wahrheit zu stellen, stirbt an der tödlichen Vermählung von Geist und Trieb, von Kontrolle und Hingabe, an jener inneren Zerreißprobe, die keine Kraft mehr findet, sich aufzulösen, und deshalb nur noch das Sterben als letzte Lösung zulässt – als eine Art Erlösung von sich selbst.
Denn dieser Tod von Gustav von Aschenbach ist kein Tod wie jeder andere. Er trägt nicht das Zeichen einer Krankheit in sich; auch wenn die Cholera ihn wie einen süßlichen, verwesenden Duft umgibt, der sich aus allen Gassen drängt, der in den Gondeln und Hotels, in den Blumenständen und Trinkwasserschläuchen wie eine unsichtbare Hand auf jeder Schulter liegt. Es ist nicht die Seuche, die ihn tötet – es ist der Zustand, in den sie ihn versetzt, die Geneigtheit zum Verfall, die Bereitschaft zur Hingabe an etwas, das nicht gesund ist, nicht moralisch und in letzter Konsequenz: nicht erlaubt; es ist ein Tod aus Eros, nicht aus Biologie, ein Tod, der langsam seine Gestalt annimmt wie eine Skulptur, die aus dem Marmor des Ichs gehauen wird.
Man könnte sagen: Aschenbach stirbt an der Schönheit – und das wäre nicht falsch, aber dann doch am Ende zu wenig. Denn die Schönheit, die ihn wie ein Fieber befällt, ist nicht nur ein Gesicht, das ihn anzieht – es ist eine metaphysische Gewalt, ein Sog, der ihn lockt, sich zu verlieren, sich zu vergessen und nach all den Jahren sich endlich jener Zwangsjacke aus Disziplin, Pflicht und moralischer Strenge zu entledigen, die er sich über Jahrzehnte so passgenau übergezogen hat, dass sie schon nicht mehr als Kleidung, sondern als eine neuerliche Haut getragen wird.
So wird der Tod in Venedig ein innerer Tod, ein Ableben vor dem Sterben und ein Prozess, der nicht erst im Moment der finalen Atemnot beginnt, sondern bereits viel früher – vielleicht in dem Augenblick, da Aschenbach auf dem Münchener Friedhof dem seltsam verkleideten Fremden begegnet, vielleicht auch erst, als er Tadzio zum ersten Mal erblickt, wie dieser, leuchtend und ferngleich, in den Speisesaal des Hotels tritt, mit jener graziösen Nachlässigkeit, die nicht zur Anstrengung, sondern zur Selbstverständlichkeit geworden ist.
Aber nein – es beginnt tatsächlich noch früher! Der Tod, dem Aschenbach entgegengeht, ist nicht plötzlich; er ist vorbereitet, eingelassen und am Ende der Taten sogar herangezogen. Er ist ein Entschluss, ein unbewusster zwar, aber darum nicht weniger eindeutig. Denn der Wunsch nach Reise, der Drang nach Aufbruch, der Impuls, sich aus dem gewohnt kontrollierten Alltag zu lösen – all das ist nichts anderes als ein Versuch, dem Leben zu entkommen, das ihn jahrelang aufrecht, aber auch innerlich erstarrt gehalten hat.
Und so erscheint Venedig, diese halbverfallene, halbentrückte Stadt, als Bühne oder Kulisse, auf jeden Fall aber als Projektion eines Todes, der nicht mehr finster und angsterfüllt ist, sondern sanft, verführerisch und bis in seine letzten Worte sinnlich. Der Tod, der sich nicht mehr aufdrängt, sondern lockt. Wie Tadzios Blick, der nicht fordert, nicht spricht – sondern bloß existiert, wie ein Leuchten am Rand des Horizonts, das nie näherkommt, aber auch nie ganz verschwindet.
Tadzio ist dabei nicht Täter, nicht Versucher und auf keinen Fall der Gehilfe des Teufels – er ist Erscheinung, Symbol, vielleicht Engel, auf jeden Fall gottähnlich; und Aschenbach ist kein Liebhaber im gewöhnlichen Sinn – er liebt nicht den Jungen, sondern das, wofür er steht: das Formlose, das Leichte, das Jenseitige. Er begehrt nicht den Körper, sondern das Ideal; er will nicht besitzen, sondern schauen; und doch wird genau dieses Schauen, dieses Nicht-Berühren-Können zu seiner, zu Aschenbachs Vernichtung – denn es zeigt ihm, was ihm fehlt, und lässt ihn zugleich unfähig, diesen Mangel zu überwinden.
So wird sein Tod ein Blick in die Sonne – so wie jener mythische Ikarus, der fliegt, nicht weil er fliehen will, sondern weil ihn das Licht ruft, weil die Höhe ihn betört, weil der Sturz schon im Aufstieg immanent enthalten ist. Aschenbach stürzt nicht durch einen Fehltritt, sondern weil er zu lange in die Schönheit geblickt hat, zu lange in jenes Licht, das nicht für Menschen gedacht ist, sondern für Götter, für Träume, gebannt in Bildern.
Wie lächerlich wirkt er dabei – geschminkt, gepudert, mit künstlicher Haarfarbe und Parfum, ein alter Mann, der sich eine zweite Jugend auf das Gesicht malt, während der Körper schon den letzten Gang antritt. Aber diese Lächerlichkeit, sie ist nicht bloß Komik – sie ist Tragik in reinster Form, denn sie offenbart nicht Torheit, sondern Sehnsucht; nicht Verblendung, sondern Verzweiflung; nicht Eitelkeit, sondern das unbedingte Bedürfnis, für einen Moment wahrhaft lebendig zu sein, nicht als Schriftsteller, nicht als Vorbild und auch nicht als Figur der Öffentlichkeit, sondern als Mensch, als Mann und als fühlendes Wesen, das lieben will – geliebt werden will – und daran am Ende zugrunde geht.
Der Tod in Venedig ist also kein Unfall, keine bloße Folge der Umstände – er ist das letzte Glied in einer Kette innerer Entscheidungen, bei der jedes Glied ein bisschen weicher wird, ein bisschen nachgiebiger, ein klein wenig näher am Abgrund als das vorherige. Er ist das Resultat einer allmählichen Öffnung nach innen, eines Auflösens der Schutzmechanismen, des heimlichen Kapitulierens vor jener Macht, die Aschenbach so lange bekämpft hatte: das Ungeordnete im Wilden, das Triebhafte im mannhaften Wesen.
Wenn er am Ende, geschwächt, überhitzt, allein, verträumt auf dem Liegestuhl sitzt und Tadzio am Strand betrachtet, wie dieser sich ins Wasser wagt, sich umdreht, fast segnend in seiner Haltung wirkt, dann ist das kein letzter Blick der Lust mehr, sondern einer der Hingabe – einer, der sagt: Ich komme. Nicht zu dir, sondern zu dem, wofür du stehst. Zu der Wahrheit, die mir entglitten ist, zu der Freiheit, die ich nie wagte, und letzten Endes zu dem Tod, der in deinem Lächeln nicht mehr Bedrohung, sondern die reinste Form der Erlösung ist.
Aschenbach stirbt – mit offenen Augen und einem Blick, der vielleicht nicht mehr sieht, aber endlich nicht mehr urteilt. Venedig schweigt, während das Meer weiter rauscht. Und irgendwo, verborgen zwischen den Gassen, verströmt der Tod weiterhin seinen Duft – süß, verheißungsvoll und mit einer unerwarteten Schönheit.