Der unzeitmäßige König
[Kurzgeschichte. Veröffentlicht in Fantasia 1245e. 2025]
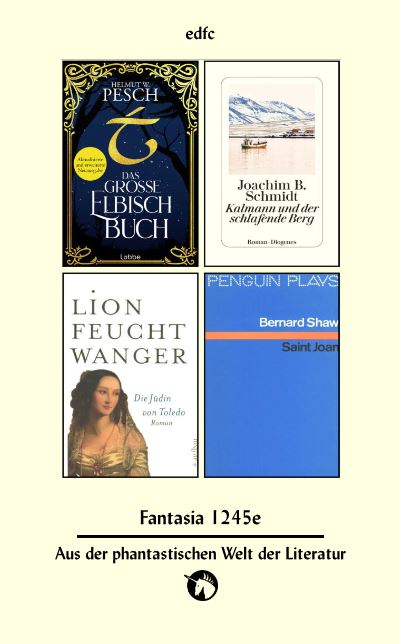
Der unzeitgemäße König
Kapitel I – Der König aus der Mitte Europas
Es war, als habe ein Jahrhundert, das selbst im Rhythmus von Katastrophen und Erschütterungen zu atmen schien, all seine widersprüchlichen Kräfte, sein fieberndes Drängen nach Erneuerung und sein unablässiges Zurückzucken vor dem Neuen in einer einzigen Landschaft verdichtet, und diese Landschaft hieß Böhmen; dort, wo die Wälder dunkel waren und die Städte von den Narben vergangener Kämpfe gezeichnet, wo das Wort „Glaube“ nicht als selbstverständliche Form eines fest gefügten Weltbildes empfunden wurde, sondern als Sprengsatz, der jede Ordnung zu zerreißen drohte, erhob sich eine Gestalt, die niemand vorhergesehen hatte: ein Mann ohne dynastische Krone, ohne ererbte Legitimität, aber ausgestattet mit der merkwürdigen Kraft, gerade aus dem Chaos die Möglichkeit einer Ordnung zu formen.
Georg von Podiebrad – geboren in den Jahren, da die Brandzeichen der hussitischen Aufstände noch frisch in den Mauern glühten, da das Land mehr einer Schlachtbank als einem Reich glich – wuchs nicht wie jene Fürstensöhne auf, die, von den Händen gelehrter Präzeptoren gehalten, in den Spiegeln höfischer Säle lernten, die Welt zu betrachten; er wuchs unter dem Donner von Predigten auf, die man noch im Blut erstickte, unter dem Echo von Prozessionen, die so leicht in Aufruhr übergingen, dass kein Tag und kein Jahr von der Unruhe unberührt blieben, und es war, als habe diese ständige Erfahrung der Zersplitterung in ihm die paradoxe Sehnsucht geweckt, nicht über ein Reich zu herrschen, sondern es zu einigen.
Wer die Chroniken dieser Zeit liest, der spürt sofort den eigentümlichen Atem einer Gesellschaft, die niemals zur Ruhe kommt, die im Wechselspiel von Fehde, Aufruhr und vermeintlichem Frieden gleichsam schwindelig geworden ist; die Hussitenkriege hatten den Boden vergiftet, das Misstrauen zwischen den Konfessionen war ein glühender Graben, der durch Städte, Dörfer und Familien schnitt, und die Autorität des Königs, längst eine blasse Fiktion, vermochte nicht mehr, das Land zusammenzuhalten. Dass inmitten dieser Wirren ein Mann aus dem Geschlecht der Podiebrad – von Adel, doch nicht von hohem Rang, angesehen, aber keineswegs dazu bestimmt, jemals den Thron zu berühren – schließlich den Königstitel tragen sollte, war eine jener Überraschungen, die nicht aus genealogischen Berechnungen geboren werden, sondern aus der nackten Notwendigkeit, dass einer den Mut aufbringt, sich in die Mitte des Strudels zu stellen, während alle anderen vor der Gewalt der Strömung zurückweichen.
Denn Georg war keiner jener glanzvollen Erscheinungen, deren äußerer Glanz sie gleichsam zur Herrschaft bestimmt hätte; er war kein geborener Sieger oder blendender Rhetor, nicht einer von früh an gefeierten Heerführern, sondern ein Mann, dessen Kraft gerade im Ausgleich und in der beharrlichen Standhaftigkeit bestand, in der Fähigkeit, auf zwei verfeindete Lager zugleich zuzugehen, ohne von dem einen verschlungen oder vom anderen verstoßen zu werden – und es war eben dies, was ihn geeignet machte, Böhmen in einer Stunde der Zerrissenheit nicht nur zu verwalten, sondern ihm für eine kurze Zeit jene Gestalt zu verleihen, die wie ein verheißenes Abbild einer größeren, europäischen Ordnung wirken sollte.
Man stelle sich die Atmosphäre in Prag jener Tage vor: die Gassen erfüllt vom Gerücht über neue Predigten, vom Argwohn gegenüber dem Nachbarn, von dem dumpfen Dröhnen, das aus der Ferne die Bewegungen der Heere verriet; und inmitten dieser nervösen Stadt erhebt sich der Landesverweser Georg, nicht als glanzvoller Souverän, sondern als nüchterner Vermittler, der die Sprache der Bauern ebenso verstand wie die Intrigen des Adels, der geduldig genug war, sich durch endlose Verhandlungen zu arbeiten, und kühn genug, den Augenblick zu ergreifen, da aus dem Chaos ein neues Machtzentrum geschaffen werden konnte.
So wurde er, 1458, von den Ständen zum König gewählt – eine Wahl, die weniger das Siegel eines alten Rechts als vielmehr den Schrei nach einer neuen Legitimität bedeutete, denn nie zuvor hatte das böhmische Reich einen König aus eigenem Willen hervorgebracht, nie zuvor war die Stimme des Landes stärker gewesen als in dieser Stunde, da man Georg, den Utraquisten, jenen Mann der Mitte, als Schild gegen die Extreme wählte – und vielleicht war dies der Augenblick, da sich bereits die Spur einer größeren Idee abzeichnete: dass Legitimität nicht allein durch Geburt, sondern durch Übereinkunft, nicht durch Blut, sondern durch Einverständnis entstehen konnte – ein Gedanke, der, weit über das böhmische Reich hinaus, wie ein kaum hörbarer Vorbote jenes föderativen Prinzips war, das später die Träume Europas bestimmen sollte.
Aber in diesen ersten Jahren seiner Herrschaft lag noch nichts von der Größe des Plans, der ihn später in den Erinnerungen der folgenden Menschheitsgenerationen unsterblich machen sollte; zunächst war er nichts als der König eines tief gespaltenen Landes, der mühsam zwischen Rom und Prag, zwischen Adel und Bürgertum, zwischen Tradition und Aufbruch lavierte, und dennoch ahnte man in der Beharrlichkeit dieses Mannes, dass seine Kraft weniger in den Waffen als in seinen Gedanken lag. Denn wer in einer Welt regiert, die von Hass durchtränkt ist, und dennoch nicht vom Hass gezeichnet wird, wer inmitten der Fäulnis des Krieges den Gedanken an Frieden nicht aufgibt, der trägt bereits einen Keim in sich, der über seine Zeit hinausweist – und es war dieser Keim, der in Georg von Podiebrad lebte, lange bevor er seinen Namen mit der Idee einer neuen Ordnung Europas verband.
Kapitel II – Der Utraquist und die Spannung der Konfessionen
Wenn man begreifen will, warum die Gestalt Georgs von Podiebrad so eigentümlich aus der Geschichte herausragt, wie ein einzelner glänzender Turm in einer Landschaft der Ruinen, dann darf man nicht zuerst auf seine politischen Erfolge oder auf den Glanz seiner diplomatischen Vision blicken, sondern muss den Blick tiefer senken, hinein in jene religiöse Spaltung, die Böhmen seit den Tagen Jan Hus’ zu einer brennenden Wunde Europas gemacht hatte, und deren offenes Blut sich selbst in die unscheinbarsten Alltagsgesten ergoß, sei es im Zögern beim Gebet, im Argwohn gegenüber dem Nachbarn oder sei es im nervösen Schweigen beim gemeinsamen Mahl, weil ein jeder wusste, dass der andere nicht nur anders dachte, sondern anders glaubte, und dass gerade dieser Unterschied den Abgrund bedeutete.
Denn das Land war in zwei Seelen gespalten: Auf der einen Seite die Katholiken, die, der Autorität Roms treu ergeben, in der unerschütterlichen Gewissheit lebten, dass allein die Einheit mit der Kirche die Ordnung garantiere; auf der anderen Seite die Hussiten, die in der Erinnerung an den verbrannten Reformator ihre eigene Wahrheit suchten und in den Kelch, den sie den Gläubigen reichten, das Symbol einer neuen, unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott legten; und dazwischen, gleichsam als Brücke und doch als Gegenstand des Misstrauens beider Seiten, standen die Utraquisten, jene gemäßigten Hussiten, die das Abendmahl in beiderlei Gestalt forderten, aber dennoch den Gedanken der Einheit mit der Kirche nicht ganz aufgeben wollten – und zu diesen Utraquisten gehörte Georg von Podiebrad – nicht als bloßer Bekenner einer Konfession, sondern als einer, der in dieser Mittelstellung sein Schicksal fand.
Man stelle sich vor, was es bedeutet haben muss, in einer Zeit zu leben, in der jede dogmatische Entscheidung nicht nur über das Seelenheil, sondern über das Leben und Sterben entschied, in der die kleinste Abweichung vom Ritual, der geringste Zweifel an der Auslegung den Verlust der Gemeinschaft und damit die Verurteilung zum Elend oder gar zum Tod bedeuten konnte; und doch war es Georg, der sich nicht in die absolute Treue zu einer Seite flüchtete, sondern in der gefährlichsten aller Positionen ausharrte, im Versuch, zu vermitteln, zu verbinden und am Ende auszugleichen – eine Haltung, die Mut erforderte, weil sie von beiden Seiten als Verrat empfunden werden konnte.
Denn Rom sah in ihm, dem utraquistischen König, stets den Ketzer, den Abtrünnigen, den Mann, der nicht mit ganzer Seele in der Autorität der Kirche ruhte; und die radikaleren Hussiten wiederum hielten ihn für zu schwach, für einen Kompromissler, für einen, der die Leidenschaft ihrer Überzeugung durch Zugeständnisse verwässerte. So stand Georg einsam in der Mitte, und doch war es gerade diese Einsamkeit, die ihn befähigte, weiter zu sehen als die Fanatiker zu beiden Seiten, die blind vor Hass und Eifer jede Brücke zerschlugen.
Sicherlich war es diese Lage, die in ihm jene fast übermenschliche Geduld erzeugte, die ihn später die mühseligen Verhandlungen führen ließ, aus denen sein europäischer Plan hervorging; denn wer es gewohnt ist, auf zwei Feuern zugleich zu tanzen, wer von beiden Seiten angegriffen und dennoch nicht verzehrt wird, der lernt, den eigenen Atem zu kontrollieren, die Zeit zu dehnen, den Augenblick zu beherrschen, bis er reif ist. Somit kann man sagen: Aus der religiösen Zerrissenheit Böhmens erwuchs in Georg die Fähigkeit zur politischen Geduld, aus dem Zwang zur Vermittlung erwuchs die Sehnsucht nach einem höheren, übergeordneten Ausgleich, aus dem ständigen Ausbalancieren der Gegensätze die Vision einer Ordnung, die größer war als das Land selbst.
Doch man darf den Preis nicht unterschätzen, den diese Stellung in der Mitte forderte; denn sie bedeutete ständige Bedrohung, das Gefühl, niemals ganz dazuzugehören, immer auf Messers Schneide zu wandeln. Die Exkommunikation durch Papst Paul II., die später gegen ihn verhängt wurde, war nicht einfach ein juristisches oder theologisches Urteil, sie war der symbolische Ausdruck jener tiefen Fremdheit, die ihn stets von der Autorität Roms trennte, und zugleich die Verurteilung eines Mannes, der in den Augen der Kurie das gefährlichste aller Dinge wagte: das Experiment der Toleranz.
Aber Georg war nicht der Mann, der sich von Drohungen verschrecken ließ; er war zu nüchtern, zu sehr in der harten Wirklichkeit der böhmischen Wirren geformt, um sich durch Bannflüche in die Knie zwingen zu lassen. Vielleicht gerade, weil er wusste, dass die Erde unter seinen Füßen jederzeit zerbrechen konnte, klammerte er sich nicht an die Illusion ewiger Sicherheit, sondern suchte den Weg nach vorn – ein Weg, der nur möglich war, wenn man den Hass nicht erwiderte, sondern überwand. In dieser Haltung liegt etwas, das ihn weit über die Durchschnittsgestalt eines spätmittelalterlichen Königs hinaushebt, etwas, das ihn mit jenen seltenen Persönlichkeiten der Geschichte verbindet, die nicht in erster Linie durch Schlachten, sondern durch Gedanken die Welt bewegten.
Denn die religiöse Spannung, die ihn umgab, war nicht nur eine Last, sondern auch eine Quelle der Inspiration: Wie ein Schmied, der aus widerspenstigem Erz eine Klinge formt, so schmiedete Georg aus den Gegensätzen seines Landes die Idee, dass Einigung möglich sei, nicht durch Unterwerfung, sondern durch Ausgleich, nicht durch Gewalt, sondern durch Verständigung. Wenn später sein Name mit dem Plan einer europäischen Friedensordnung verbunden wurde, so war dieser Gedanke nicht wie ein Blitz aus heiterem Himmel entstanden, sondern die logische Folge jener jahrelangen Übung im Aushalten der Mitte, jener Erfahrung, dass die Welt nicht schwarz oder weiß ist, sondern aus unendlichen Graustufen besteht, die man zu erkennen und zu respektieren lernen muss.
So erscheint Georg von Podiebrad in dieser Zeit der konfessionellen Spannung als eine Art Vorläufer jener modernen Gestalt des Vermittlers, des Politikers, der nicht aus fanatischem Eifer, sondern aus geduldiger Vernunft handelt; und doch ist er, wie alle Vorläufer, auch tragisch, weil die Zeit noch nicht reif war für das, was er verkörperte. Die Welt um ihn verlangte nach klaren Fronten, nach kompromissloser Treue, nach absoluter Unterordnung unter eine Autorität, sei es Rom oder die radikale Predigt – und dazwischen stand dieser König, der nichts anderes wollte, als das Land im Frieden zu halten, und der gerade deshalb zum Feindbild aller wurde.
Aber letzten Endes ist es das, was seine Gestalt so faszinierend macht: dass er wagte, in der Mitte zu stehen, wo es am gefährlichsten war, und dass er, aus dieser Mitte heraus, den Mut fand, größer zu träumen, als es seine Gegenwart erlaubte.
Kapitel III – Der Traum eines neuen Europas
Es gibt Augenblicke in der Geschichte, in denen ein Gedanke, geboren aus der Verzweiflung einer zerrissenen Gegenwart, weit hinausgreift über die Möglichkeiten seiner Zeit, wie ein Ast, der sich ins Leere reckt, weil der Stamm, aus dem er entspringt, noch nicht kräftig genug ist, die Früchte zu tragen, die er bereits in seiner Knospe verspricht; und ein solcher Gedanke war der Traum Georgs von Podiebrad, nicht mehr nur Herrscher eines zerrissenen böhmischen Reiches zu sein, sondern Begründer einer Ordnung, die die ganze Christenheit umspannen sollte, getragen nicht vom Schwert, sondern vom Einverständnis.
Denn was sich in seinem Geist formte, war nicht die naive Hoffnung eines schwärmerischen Idealisten, der im Nebel des Wünschbaren die harte Realität der Macht vergisst, sondern die reif gewordene Einsicht eines Mannes, der Tag für Tag erlebt hatte, wie sinnlos es war, wenn ein Reich sich selbst verzehrte, weil jede Partei auf ihrem alleinigen Recht bestand; aus der bitteren Erfahrung der böhmischen Konfessionen erwuchs der Gedanke, dass Einigung auf höherer Ebene nur möglich sei, wenn die Mächte Europas ihre Ansprüche mäßigten, wenn sie ihre ständige Neigung zu Fehde und Intrige durch ein System banden, das sie nicht zerstörte, sondern verband.
So entstand – unter Mitwirkung des gelehrten Juristen Antonius Marini aus Grenoble und des Staatswissenschaftlers Martin Mair – jener Traktat, der aus einundzwanzig Artikeln bestand und dessen trockene juristische Sprache kaum zu erahnen vermag, welch kühne Vision sich darin verbarg: ein ewiger Bund der christlichen Fürsten, ein gemeinsames Heer, um die Grenzen gegen das Osmanische Reich zu schützen, eine zentrale Verwaltung, die über die Streitigkeiten der Mitglieder entschied, ein Parlament, das Gesetze für alle erließ, ein gemeinsamer Haushalt, ein Gericht, ja sogar ein Wappen, das die Einheit symbolisieren sollte – kurz, eine Ordnung, die, Jahrhunderte vor Kant und Rousseau, das utopische Bild eines vereinigten Europas in nüchterne Paragraphen fasste.
Man muss sich vergegenwärtigen, wie ungeheuerlich dieser Plan war: Denn er entzog dem Papst die Rolle des obersten Friedensstifters, indem er die Entscheidung über Kriege und Konflikte den Fürsten selbst überließ; er schwächte die Autorität des Kaisers, indem er sie in einem kollektiven Organ relativierte; er setzte der Willkür des Schwertes die Vernunft des Vertrages entgegen. Es war, als habe sich in Böhmen, an der Nahtstelle zwischen Ost und West, inmitten der größten Zerrissenheit die kühne Idee eines Europas geformt, das sich nicht mehr in den Schlachten seiner Könige verausgabte, sondern in der Einigkeit seiner Staaten Kraft fand.
Doch so nüchtern der Traktat sich lesen mag – in Georg selbst brannte das Pathos einer Vision: Er wollte nicht bloß die Ordnung seines Reiches retten, er wollte die Christenheit gegen die Bedrohung durch den Halbmond vereinen, und mehr noch, er wollte eine Struktur schaffen, die dem ewigen Kreislauf der Kriege, in denen Europa sich selbst verzehrte, ein Ende setzte. In dieser Sehnsucht lag etwas, das weit über den Pragmatismus hinausging: Es war die tiefe, beinahe mystische Hoffnung, dass der Mensch, dieses unruhige Wesen, fähig sei, aus Vernunft zu handeln und die Gewalt zu überwinden, nicht durch göttliches Eingreifen, sondern durch seine eigene Eintracht.
Natürlich war es dies, was Georg so unzeitgemäß machte, dass er nicht auf die nächste Schlacht, den nächsten Thron oder das nächste, unstete Bündnis fixiert war, wie die Fürsten seiner Epoche, sondern auf ein übergeordnetes Gebilde, das ihm wie eine Vorwegnahme der Zukunft erschien; und hierin liegt die tragische Schönheit seiner Gestalt, dass er die Gegenwart überschritt, ohne sie überwinden zu können, dass er den Traum formulierte, aber nicht verwirklichte, und dass er, wie alle großen Vorläufer, den Fluch der Einsamkeit trug, den nur jene kennen, die weitersehen als die, unter denen sie leben.
Man muss sich den König in Prag vorstellen, wie er, umgeben von Gelehrten und Räten, über die Pergamente gebeugt ist, während draußen in den Straßen das Volk sich an Predigten entzündet und die Wut der Glaubensspaltung lodert; wie er in der Stille seiner Ratsstube den Blick über sein Land hinaus richtet, nicht mehr auf Böhmen, sondern auf Frankreich, Burgund, England, Spanien, Italien, und in seiner Vorstellung die Mosaiksteine dieser Länder zu einem Bild zusammensetzt, das größer ist als die Summe seiner Teile; wie er, mitten in einem Zeitalter, das kaum den Gedanken der Toleranz kannte, von der Vernunft träumt, die Grenzen und Kronen übersteigen könnte – ein König, der kein Weltreich suchte, sondern einen Bund – ein Einverständnis.
Doch zugleich wusste er, dass er mit diesem Gedanken gegen die Ordnung der Welt verstieß, dass die Kirche, die über Jahrhunderte den Anspruch erhoben hatte, das Band der Christenheit zu sein, in ihm den gefährlichsten Rivalen sah, weil er eine Einheit ohne Rom dachte, eine Gemeinschaft der Fürsten, die nicht mehr in der Kurie, sondern in sich selbst die Quelle ihrer Legitimität fand. Es ist bezeichnend für das Schicksal solcher Ideen, dass sie, je kühner sie sind, desto härter auf den Widerstand derer stoßen, die die Gegenwart bewahren wollen, und so war es auch mit Georg: Kaum war der Plan gefasst, begann schon die Intrige, ihn zu unterminieren.
Doch für einen Augenblick hatte die Vision Flügel, noch bevor sie in den Kerkern der Wirklichkeit gebrochen wurde: Botschaften wurden gesandt, Verhandlungen eröffnet, eine große Gesandtschaft vorbereitet, die das Wort Böhmens in die Höfe Europas tragen sollte. In diesem Augenblick, da die Idee noch jung war, da sie noch nicht an den Grenzen des Möglichen zerschellt war, schimmerte sie wie eine Morgenröte, deren Licht über den Hügeln liegt, bevor die Sonne wirklich aufgegangen ist.
So beginnt die Geschichte eines Traums, der aus den Narben der Hussitenkriege geboren wurde und doch weiterreichte, als irgendwer seiner Zeit hätte ahnen können: die Geschichte des ersten Plans für ein geeintes Europa, gedacht von einem König, den man nicht aus Geburt, sondern aus Notwendigkeit gewählt hatte, und der, gerade deshalb, den Mut fand, das Notwendige zu überschreiten.
Kapitel IV – Die große Gesandtschaft
Es gibt Momente, in denen ein Gedanke, eben noch kaum mehr als Tinte auf Pergament, aus den engen Stuben der Gelehrten hinaustritt und Fleisch und Blut annimmt, indem er sich in die Gestalt von Menschen kleidet, die durch Länder ziehen, an fremden Höfen auftreten, in Sprachen reden, die sie kaum beherrschen, und durch ihr bloßes Dasein bezeugen, dass eine Idee nicht länger nur Traum, sondern schon Wirklichkeit im Anfangsstadium ist; und ein solcher Moment war die Abreise jener großen Gesandtschaft, die Georg von Podiebrad in die Länder Europas entsandte, um den Fürsten seiner Zeit den Plan eines ewigen Bundes vorzulegen.
An ihrer Spitze stand sein Schwager, Lev von Rožmital, ein Mann von Welt, der mehr als andere imstande war, die feine Kunst der Repräsentation zu beherrschen, die damals mehr Gewicht hatte als tausend wohlgesetzte Worte; denn es galt nicht nur, einen Traktat zu überbringen, sondern durch die Würde der Erscheinung, durch die Noblesse der Haltung, durch die Grazie des Umgangs zu zeigen, dass aus Böhmen, diesem zerrissenen Land, dennoch eine Botschaft von Gewicht kommen konnte. Begleitet wurde er von einem Gefolge, das reich genug ausgestattet war, um Eindruck zu machen, und doch genügsam genug, um nicht den Neid der Höfe zu erregen; und so zogen sie, wie ein kleiner Hofstaat, durch die Länder, die bald als Bühne der großen Idee erscheinen sollten.
Man stelle sich die Reise vor, die von Prag aus begann, durch die Täler des Reiches und über Flüsse und Gebirge führte, hinein in die Länder, deren Namen damals nicht weniger schillernd klangen als heute: die Märkte von Flandern mit ihrem Gewühl von Händlern und ihren Türmen, die wie Finger in den Himmel ragten; die Hallen Frankreichs, wo noch der Glanz des Rittertums in höfischen Spielen lebte; die windumtosten Küsten Englands, wo man mit der Nüchternheit einer Nation sprach, die mehr auf das Meer als auf das Land vertraute; die Höfe Spaniens und Portugals, die am Rande Europas zugleich das Tor zur unbekannten Welt bildeten; und schließlich die glänzenden Städte Italiens, wo die Renaissance bereits wie ein junger Frühling die alten Mauern umrankte.
Überall, wo die Gesandtschaft erschien, war das Erstaunen groß: dass ein Land, das man noch immer mit dem Schreckbild der Hussitenkriege verband, nun nicht Krieg, sondern Frieden predigte; dass von dort, wo man die Ketzer vermutete, eine Botschaft kam, die nicht Trennung, sondern Einheit forderte. Man hörte ihnen zu, höflich, mit dem Lächeln, das Fürsten ihren Gästen schenken, wenn sie zugleich neugierig und misstrauisch sind; man ließ sie an Banketten teilnehmen, bewunderte die edle Erscheinung der Herren und die Disziplin ihrer Diener, man tauschte Geschenke, man verfasste freundliche Schreiben – und doch blieb hinter all dem höfischen Glanz die eigentliche Frage offen, ob irgendeiner der Mächtigen bereit war, den Gedanken ernst zu nehmen, der in den Schriftrollen lag.
Denn es war nicht nur ein Plan für Frieden, den sie mit sich führten, es war ein Angriff auf die geheiligte Ordnung der Macht; und so lächelten die Könige und Herzöge, während sie innerlich zögerten, weil sie ahnten, dass, wenn sie sich diesem Bund anschlössen, sie etwas von ihrer Freiheit aufgeben müssten, ein Stück jener unumschränkten Gewalt, die ihnen mehr wert war als tausend Siege. So schwebte die Gesandtschaft gleichsam zwischen zwei Wirklichkeiten: In den Festen, den überschwänglichen und dabei oberflächlichen Zeremonien, den festlichen Umzügen, war sie Triumphzug einer neuen Idee, doch im Herzen der Höfe war sie nichts als eine höfliche Zumutung, die man mit artigem Wohlwollen zur Seite legte.
Dennoch – die Reise selbst, unabhängig von ihrem Ergebnis, hatte den Charakter eines Abenteuers des Gedankens; sie war wie ein Pilgergang einer Idee durch die Länder Europas, und in den Chroniken klingt etwas von jener eigentümlichen Mischung aus Stolz und Wehmut, die diesen Zug begleitete. Denn die Männer, die ihn vollführten, wussten wohl, dass sie ein Werk von einzigartiger Bedeutung verrichteten, aber sie ahnten zugleich, dass ihre Zeit vielleicht noch nicht bereit war, die Größe zu fassen, die sie verkörperten.
Wenn man die Berichte liest, die von dieser Reise erhalten sind, dann spürt man die Eindrücke einer Epoche, die noch im Alten stand, aber schon von Neuem berührt war: wie die Gesandten durch die Handelsstädte Flanderns zogen, wo die Händler sie mit Staunen empfingen, weil ein König aus Böhmen an sie dachte; wie sie in Frankreich die Ritterspiele sahen, deren Glanz schon hohl war und doch das Auge blendete; wie sie in England, am Hof Heinrichs VI., die Kälte spürten, die aus einer Nation sprach, die ihre eigene Linie verfolgte und wenig Neigung zeigte, sich einem Bund zu unterwerfen; wie sie in Spanien und Portugal die Atmosphäre der Seefahrer atmeten, die mehr auf die unbekannten Ozeane blickten als auf die Kriege des Kontinents; und wie sie schließlich in Italien, in Florenz und Rom jene widersprüchliche Erfahrung machten, dass dort, wo die Kunst blühte und die Vernunft sich in den Wissenschaften neu entfaltete, der Wille zur politischen Freiheit am stärksten gefesselt blieb.
Es war, als hätte die Reise selbst ein großes Bild gezeichnet: Europa, reich, vielfältig, voller Glanz und Möglichkeiten, und doch unfähig, sich zu einigen; jeder Hof, jedes Reich für sich, jeder Fürst ein Juwel, das funkelte, aber kein Band, das sie alle zusammenhielt.
So kehrte die Gesandtschaft nach Jahren der Reise, nach ungezählten Begegnungen, zurück nach Böhmen, reich an Erfahrungen, beladen mit Geschenken, mit Schriften, mit Berichten, aber arm an Zusagen; die Höfe hatten sie empfangen, sie hatten gelächelt, sie hatten zugehört, aber sie hatten nicht gehandelt. Es war das Schicksal vieler großer Ideen, dass sie zwar Bewunderung erregen, aber keine Entscheidung; und auch dieser Plan, der vielleicht das Antlitz Europas verändert hätte, blieb in den höfischen Archiven liegen, während die Welt ihren gewohnten Weg ging.
Im Rückblick liegt jedoch in dieser Gesandtschaft etwas, das über ihren praktischen Misserfolg hinausweist: Sie war der erste Versuch, Europa als Einheit zu denken und zu bewerben, nicht in der Sprache des Schwertes, sondern in der Sprache der Diplomatie; und selbst wenn die Höfe ablehnten, so hatten sie doch, für einen Augenblick, die Vorstellung gekostet, dass es möglich sei, nicht gegeneinander, sondern miteinander zu handeln. Und dieser Augenblick, so kurz er auch war, blieb als Samen zurück, verborgen in den Archiven, aber bereit, Jahrhunderte später wieder zu keimen.
Kapitel V – Der Widerstand Roms und das unaufhaltsame Scheitern
Es liegt eine beinahe gesetzmäßige Grausamkeit in der Geschichte, dass jeder Gedanke, der seiner Zeit zu weit voraus ist, nicht an seinen inneren Mängeln zerbricht, sondern an der übermächtigen Beharrungskraft der Institutionen, die sich durch ihn bedroht fühlen; und so war es auch mit dem Plan Georgs von Podiebrad, denn sobald die Kunde von seinem föderativen Friedensbund die Mauern Roms erreichte, erwachte dort jener uralte Instinkt der Abwehr, den alle zentralen Mächte besitzen, wenn sie erkennen, dass hier etwas gedacht wird, was ihre eigene Autorität relativieren, ja in ihren Fundamenten erschüttern könnte.
Denn der Papst Paul II. war nicht gewillt, ein Bündnis zu dulden, das die Christenheit ohne den Bischof von Rom zu organisieren suchte; er sah darin nicht den Traum einer höheren Ordnung, nicht den Versuch, die Kräfte Europas gegen die Gefahr des Osmanischen Reiches zu bündeln, sondern schlicht eine ketzerische Usurpation, eine Art säkulare Kirche ohne geistliche Spitze, und damit eine Herausforderung, die im Kern gefährlicher war als die wildesten Predigten der Hussiten. Denn Prediger kann man verbrennen, Aufstände kann man blutig niederschlagen, aber einen König, der es wagt, den Gedanken einer eigenständigen Gemeinschaft zu formulieren, die der Kirche die Schiedsrichterrolle entzieht, den muss man mit Bannfluch belegen, um sein Wort in Staub zu verwandeln.
So geschah es: 1466 verhängte Paul II. den Bann über Georg von Podiebrad, erklärte ihn zum Ketzer, zum Feind der Kirche, und trennte damit den König nicht nur von der geistlichen Gemeinschaft, sondern entzog ihm zugleich jene Legitimität, die im Mittelalter noch untrennbar mit der Gnade Roms verbunden war. Doch Georg, in der Härte der böhmischen Wirren geformt, ließ sich von diesem Donnerwort nicht erschüttern; er wusste, dass die Autorität der Kirche mächtig war, aber er wusste ebenso, dass sein Land ihn brauchte, und er hielt stand wie einer, der im Sturm den Mantel fester um sich schlägt, weil er gelernt hat, dass man die Elemente nicht besiegen, wohl aber überstehen kann.
Doch während Georg standhielt, begannen die politischen Risse sich um ihn herum zu vertiefen: Der ungarische König Matthias Corvinus, einst sein Verbündeter, wandte sich gegen ihn, angelockt von päpstlichen Versprechungen und der Aussicht, das böhmische Erbe zu ergreifen. Im Reich, ohnehin misstrauisch gegenüber dem hussitischen König, mehrten sich die Stimmen, die seine Absetzung forderten, und so stand Georg, der eben noch den Traum eines vereinten Europa zu verkünden gewagt hatte, plötzlich allein, bedrängt von außen, untergraben von innen, wie ein Mann, der den Gipfel erklommen hat und nun zusehen muss, wie die Steine unter seinen Füßen zu bröckeln beginnen.
Es ist eine der tragischen Konstellationen der Geschichte, dass gerade in dem Augenblick, da ein Gedanke seine Gestalt zu zeigen beginnt, die Gegenkräfte mit einer Heftigkeit erwachen, die ihn fast unvermeidlich zerschlägt; und doch darf man nicht übersehen, dass dieses Scheitern nicht die Ohnmacht der Idee, sondern die Stärke der Gegner beweist, die sich durch sie bedroht fühlen. Georgs Bund, so wenig er praktisch verwirklicht wurde, hatte die Macht, Rom in Panik zu versetzen, den Papst zu Bann und Fluch greifen zu lassen, die Nachbarn zu Waffen und Intrigen zu bewegen – und dies allein beweist, dass die Idee, noch bevor sie Gestalt annahm, bereits Kraft genug besaß, um die Weltordnung zu erschüttern.
Für Georg selbst jedoch bedeutete es eine bittere, fast existenzielle Niederlage. Er, der sich sein Leben lang an die Rolle des Vermittlers gewöhnt hatte, musste nun erkennen, dass Vermittlung ihre Grenze findet, wenn der Gegner nicht verhandeln, sondern zerstören will. Er, der in Böhmen gelernt hatte, durch Geduld und Ausgleich Frieden zu bewahren, musste nun erleben, dass es Mächte gibt, die nur in der Vernichtung des anderen ihre Sicherheit suchen. Und so wandelte sich der Traum, der eben noch wie ein Morgenlicht über Europa gelegen hatte, in einen Schatten, der immer tiefer auf sein Leben fiel.
Doch wer meint, Georg sei an diesem Punkt zerbrochen, der verkennt die innere Größe dieses Mannes. Er resignierte nicht, er knickte nicht ein, er kämpfte bis zuletzt um den Erhalt seiner Krone, seines Landes und vor allem seiner Idee, auch wenn er ahnte, dass die Kräfte gegen ihn übermächtig waren. Es lag in dieser Standhaftigkeit, in diesem stolzen Ausharren gegen Bann und Bedrohung, etwas von jener stillen Größe, die Stefan Zweig in seinen „Sternstunden der Menschheit“ so oft beschworen hat: die Größe eines Menschen, der weiß, dass er verlieren wird, und dennoch nicht nachgibt, weil er fühlt, dass er nicht für sich selbst, sondern für eine Idee kämpft.
So sehen wir in Georg von Podiebrad, in diesen letzten Jahren seines Wirkens, die Gestalt des einsamen Königs, der zwischen Rom und den Mächten Europas keinen Verbündeten mehr findet, der von seinem eigenen Schwiegersohn angegriffen wird, der von den Bannflüchen der Kirche verfolgt wird und dennoch den Gedanken nicht preisgibt, dass Frieden durch Einigung möglich sei. Es ist die Tragik seiner Figur, dass er als König scheiterte, weil er als Visionär zu groß für seine Zeit war.
Wenn man in die Chroniken blickt, so liest man von Niederlagen, von Belagerungen, von den politischen Ränken, die sein Reich schwächten – aber über all dem steht wie eine unsichtbare Schrift das tiefere Drama: dass die Idee einer föderativen Ordnung, geboren in Böhmen, von der Welt nicht aufgenommen werden konnte, weil die Zeit noch nicht reif war, weil die Mächtigen zu sehr an ihrer eigenen Gewalt hingen, weil Rom nicht dulden konnte, dass die Christenheit sich ohne seine Führung organisierte.
Und doch: Auch wenn Georg am Ende seiner Kraft war, auch wenn die Gegner ihn bedrängten, auch wenn die Bannflüche ihn trafen wie Pfeile, blieb in ihm bis zuletzt jene unbeugsame Überzeugung, dass sein Gedanke nicht ganz verloren sei. Denn wer einen Traum in die Welt gesetzt hat, der größer ist als das eigene Leben, der weiß, dass dieser Traum vielleicht mit ihm stirbt, aber nicht mit ihm begraben wird; er weiß, dass er in den Jahrhunderten weiterwirkt, unsichtbar, wie eine unterirdische Quelle, die erst viel später ans Licht tritt.
Somit endete der Kampf Georgs gegen Rom nicht in einem endgültigen Sieg oder in einer endgültigen Niederlage, sondern in jener eigentümlichen Schwebe, die das Schicksal aller großen Visionäre bestimmt: Er verlor in seiner Zeit und gewann in der Erinnerung.
Kapitel VI – Der einsame König im Angesicht des Todes
Es kommt im Leben wirkungsstarker Menschen jener unausweichliche Augenblick, an dem die Kräfte, die sie einst getragen haben, nicht mehr ausreichen, um das Gewicht ihrer Träume zu stützen, an dem die Ideen, die über Jahre hinweg wie ein inneres Feuer in ihnen brannten, im äußeren Frost der Realität zu verlöschen scheinen, und doch bleibt im Glimmen der letzten Flammen ein Leuchten zurück, das über den Tod hinausreicht – und ein solcher Augenblick war das Ende Georgs von Podiebrad, der, von Krankheit geschwächt, von Feinden bedrängt und von Rom geächtet, dennoch bis zuletzt an jenem Gedanken festhielt, der sein Leben überragte, der Gedanke eines geeinten, friedlichen Europas.
In Prag, der Stadt, die ihn einst zum König erhoben hatte, wo die Straßen noch das Echo jener Predigten trugen, die das Land in Brand gesetzt hatten, erlebte er seine letzten Jahre nicht als Triumphator, sondern als Angefochtener, dessen Autorität durch die Exkommunikation erschüttert, dessen Reich durch Intrigen zerschnitten, dessen Nachbarschaften von Kriegen bedroht war; und dennoch hielt er sich, wie ein Mann, der sich in den Fluten an einem Felsen festklammert, der weiß, dass die Wellen ihn am Ende dennoch hinabziehen werden, und der doch nicht loslässt, weil er im Festhalten einen letzten Rest von Würde findet.
Seine Gesundheit, durch die Anstrengungen der Jahre geschwächt, begann ihn zu verlassen; er litt an Wassersucht, die seinen Körper anschwellen ließ, und jeder Schritt, jede Bewegung wurde zur Last. Dennoch arbeitete er weiter, führte Verhandlungen, beriet sich mit seinen Räten, hielt, solange seine Kräfte es erlaubten, die Zügel der Herrschaft in den Händen. Es war, als wollte er den Tod, den er nahen fühlte, hinauszögern, solange noch ein Atemzug in ihm war, um nicht den Eindruck zu hinterlassen, er habe sein Reich preisgegeben.
Aber die innere Einsamkeit, die ihn schon während seiner Herrschaft begleitet hatte, wuchs in diesen letzten Tagen zu einer fast unerträglichen Last. Er war ein König ohne sicheren Halt, denn Rom hatte ihn verstoßen, viele Fürsten hatten ihn verlassen, und selbst im eigenen Land waren die Stimmen laut, die ihn kritisierten, die seine Politik für zu weich oder zu trotzig hielten. Es war, als sei er von allen Seiten missverstanden, als habe er versucht, die Welt zu verbinden, und sei dafür von ihr verlassen worden.
Doch – gerade in dieser Einsamkeit liegt die ergreifende Größe seiner Gestalt. Denn er zerbrach nicht an ihr, er ergab sich nicht der Bitterkeit, er zog sich nicht in stumme Verzweiflung zurück, sondern hielt stand, so wie er es immer getan hatte: mit einer stillen, beinahe unbewegten Würde, die nicht im Sieg wurzelte, sondern in der Überzeugung, dass er im Recht war. Vielleicht ist es dies, was ihn von so vielen Herrschern seiner Zeit unterscheidet: dass er sein Königtum nicht als Triumph verstand, sondern als Pflicht, die auch in der Niederlage erfüllt werden musste.
Als der Tod näher kam und er, von Schmerzen gezeichnet, die Tage kaum mehr bewältigte, mag in seinem Inneren jener seltsame Frieden eingetreten sein, den nur Menschen kennen, die wissen, dass sie alles gegeben haben, was sie geben konnten; dass ihre Taten vielleicht nicht die Früchte trugen, die sie erhofft hatten, dass ihre Ideen vielleicht von der Gegenwart verspottet oder verworfen wurden, dass aber dennoch etwas von ihnen bleiben wird, ein unsichtbares Erbe, das die Zeit aufnimmt und weiterträgt.
So starb er, am 22. März 1471, in Prag, nicht als gefeierter Visionär, sondern als kranker König, von der Kirche gebannt, von vielen Fürsten gemieden, und doch mit jener inneren Größe, die sein Scheitern in ein Vermächtnis verwandelte. Denn es war kein gewöhnliches Sterben, es war das Ende eines Lebens, das mehr gewagt hatte, als es die Zeit erlaubte, und deshalb in der Niederlage den Keim des Kommenden hinterließ.
Man könnte sagen: Er starb einsam und doch nicht allein; einsam, weil seine Zeitgenossen ihn nicht verstanden, allein, weil seine Idee keine Verteidiger mehr fand, als er sie am dringendsten gebraucht hätte; und doch nicht allein, weil in diesem Augenblick der Geschichte schon der leise Widerhall jener Stimmen zu hören war, die Jahrhunderte später sein Vermächtnis aufnehmen würden.
Denn so wie ein Stern, der verglüht, sein Licht noch lange weiterstrahlen lässt, so strahlte auch von Georgs Ende ein Licht aus, das die Jahrhunderte durchdrang, bis es in den Gedanken Kants, Rousseaus und späterer Vordenker einer europäischen Einheit wieder aufflammte. Sein Tod war nicht das Ende seiner Idee, sondern ihre Verklärung; in der Niederlage lag der Triumph, in der Verwerfung das Überleben, in der Einsamkeit die Unsterblichkeit.
So bleibt das Bild Georgs von Podiebrad, wenn wir es in diesen letzten Stunden betrachten, das eines Königs, der keine Krone des Ruhmes trug, kein Zepter des Sieges hielt, sondern der in der stillen Standhaftigkeit seines Charakters jenen Glanz besaß, der größer ist als alle äußere Macht: den Glanz des Menschen, der seiner Überzeugung treu bleibt bis zuletzt.
Kapitel VII – Nachklang und Vermächtnis
Wenn man das Leben Georgs von Podiebrad betrachtet, dann mag es zunächst wie eine Episode am Rande der großen Geschichte erscheinen, wie ein Zwischenfall im vielstimmigen Ringen der Mächte des fünfzehnten Jahrhunderts, die sich um Kronen, Territorien und Privilegien stritten, und doch, wenn man tiefer blickt, offenbart sich in ihm jener seltene Augenblick, da die Geschichte einem einzelnen Menschen die Gnade gewährt, für einen Moment weiter zu sehen, als es die Gegenwart erlaubt, und eine Idee zu formulieren, die nicht seiner Zeit, wohl aber der Zukunft gehört.
Denn was blieb von ihm nach seinem Tod? Nicht ein Reich, das unter seiner Dynastie weiterblühte, nicht Siege, die in Chroniken als glanzvolle Triumphe gefeiert wurden, keine Monumente aus Stein, die die Jahrhunderte überdauerten – vielmehr blieb eine Schrift, ein Traktat, dieser eine Gedanke: der Plan, die Fürsten Europas in einem Bund zu vereinen, der nicht mehr durch das Schwert, sondern durch das Recht zusammengehalten werden sollte. In dieser Schlichtheit, ja beinahe in dieser Armut seines Erbes liegt zugleich seine Größe; denn was schwach erscheint, trägt die Kraft, über Jahrhunderte zu überdauern, während die Mauern der Sieger längst zerfallen sind.
So lebte sein Gedanke, verborgen und doch unsterblich, weiter in jenen Geistern, die die Welt mit ähnlichen Fragen quälten: ob Frieden möglich sei, nicht durch Unterwerfung, sondern durch Vernunft; ob Menschen fähig seien, ihre Neigung zum Krieg in eine Ordnung zu binden, die stärker ist als ihre Leidenschaften. Es war der Abt von Saint-Pierre, der im achtzehnten Jahrhundert den „Entwurf eines ewigen Friedens“ verfasste; es war Rousseau, der die Möglichkeit einer Gesellschaft entwarf, die auf Vertrag und Konsens beruhte; es war Kant, der in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden“ die große Frage stellte, ob die Menschheit jemals in der Vernunft jene Form finden könne, die sie aus dem Kreislauf der Gewalt erlöst – und hinter all diesen Stimmen klingt, wenn auch leise, das Echo des böhmischen Königs, der Jahrhunderte zuvor dieselbe Hoffnung in die Welt gesetzt hatte.
Aber der Nachklang reicht noch weiter, bis in unsere eigene Gegenwart, in der die Idee eines vereinten Europa nicht mehr utopische Vision, sondern politische Realität geworden ist, wenn auch brüchig, wenn auch angefochten, wenn auch gefährdet. Man könnte sagen: Die Europäische Union, mit all ihren Institutionen, Parlamenten und Gerichten, mit ihrem Bemühen, Konflikte nicht durch Krieg, sondern durch Verhandlung zu lösen, ist in gewisser Weise das späte Erbe Georgs von Podiebrad, auch wenn sie ihn nicht kennt, auch wenn sie ihn nicht feiert, auch wenn sein Name im Lärm der Jahrhunderte beinahe untergegangen ist. Und dennoch – wer genau hinhört, wer die Linien der Geschichte zurückverfolgt, erkennt, dass dieser König, der aus Not gewählt, von Rom verstoßen und von seinen Nachbarn verraten wurde, in Wahrheit einer der ersten war, die Europa als Einheit dachten.
Hier liegt die paradoxe Schönheit seines Vermächtnisses: dass er scheiterte, aber gerade im Scheitern unsterblich wurde; dass er nicht vollenden konnte, was er begonnen hatte, aber dass sein Anfang dennoch den Samen legte, der später aufgehen sollte. Denn in der Geschichte sind es oft nicht die Sieger, die die Zukunft gestalten, sondern die Visionäre, deren Gedanken zu groß sind für ihre Epoche, zu kühn für die Gegenwart, und die deshalb untergehen – um in der Erinnerung jener wiederaufzuerstehen, die später bereit sind, das zu vollenden, was einst nur als Traum gedacht war.
Somit bleibt das Bild Georgs von Podiebrad ein Bild der Tragik, aber auch der Hoffnung: ein König, der ohne Krone geboren, gegen den eigentlichen Zeitgeist gewählt wurde, ohne Zustimmung Roms geächtet und wenig siegreich gestorben ist – und der dennoch mehr bewirkt hat als viele Sieger, weil er den Gedanken in die Welt setzte, dass die Menschen nicht verurteilt sind, ewig in Fehde und Krieg zu leben, sondern dass sie fähig sein könnten, eine Ordnung zu schaffen, die größer ist als ihre eigenen Grenzen.
Dies ist es, was uns an ihm noch heute berührt: dass er nicht das Bild des strahlenden Helden bietet, nicht den Glanz des Triumphators, sondern die stille Würde eines Mannes, der scheiterte und doch recht behielt. Es ist genau diese Art von Größe, die unsere Welt, die wieder einmal zwischen Einheit und Spaltung, zwischen Vernunft und Leidenschaft schwankt, am dringendsten braucht.
Die Geschichte Georgs von Podiebrad endet daher nicht mit seinem Tod, sondern in uns, in der Frage, ob wir fähig sind, aus seiner Vision zu lernen. Denn wenn wir heute von Europa sprechen, von der Einheit des Kontinents, von der Sehnsucht nach Frieden in einer zerrissenen Welt, dann sprechen wir, bewusst oder unbewusst, die Sprache, die er vor Jahrhunderten zuerst wagte.
Uns bleibt, wenn wir auf sein Leben zurückblicken, nur dies zu sagen: dass er einer jener seltenen Menschen war, die im Voraus für die Zukunft leiden mussten, damit die Zukunft selbst sich eines Tages ihrer erinnern konnte. Ein König ohne große Siege, ein Herrscher ohne bleibenden Ruhm, ein Visionär ohne seine Erfüllung – und gerade deshalb einer der Wirkmächtigen der Geschichte der Menschen.